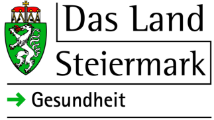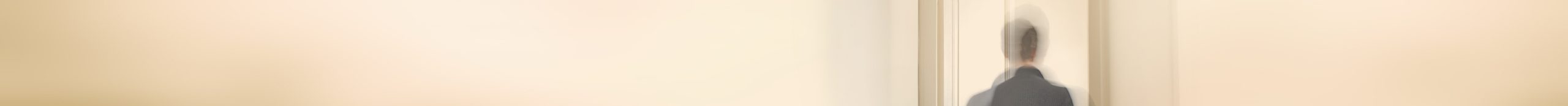
Themen auf dieser Seite:
Versorgungsangebote bei Suchterkrankungen
Rund 5.800 Steirer*innen wurden 2023 in der Steiermark in ambulanten Suchthilfeeinrichtungen betreut. Hier erfahren Sie, welche weiteren Versorgungsangebote bei Suchterkrankungen es in der Steiermark gibt.
Ambulante Suchthilfeeinrichtungen
Hier geht es zu den Angeboten der Suchthilfe in der Steiermark
Suchthilfeeinrichtungen, die eine Förderung vom Gesundheitsfonds erhalten, dokumentieren ihre Leistungen seit 2020 in einem einheitlichen Dokumentationssystem. Daten können sowohl einrichtungsbezogen als auch Klient*innen-bezogen analysiert werden.
Im Jahr 2023 wurden 5.792 Klient*innen in einer steirischen ambulanten Suchthilfeeinrichtung betreut, davon waren 5.510 (95,13 %) selbst Betroffene, 282 (4,87 %) wurden als Angehörige betreut. Die folgenden Auswertungen zeigen die Hauptbetreuungsschwerpunkte der betreuten Klient*innen und deren regionale Verteilung in der Steiermark. Alkohol ist der häufigste Betreuungsschwerpunkt, gefolgt von illegalisierten Substanzen und der Opioid-Agonisten-Therapie (Opioid-Substitution).
Abb. 913: Verteilung der Hauptbetreuungsschwerpunkte in ambulanten Suchthilfeeinrichtungen.
Nach Kliententypus für Steiermark gesamt, 2023
Grundgesamtheit: gesamt = 5.792
Einrichtungsklientendaten aus dem Fördercontrolling Sucht; Berechnung und Darstellung: EPIG GmbH
Veröffentlicht am 20.11.2025, Download von https://gesundheitsbericht-steiermark.at/
Die folgende Abbildung zeigt die Verteilung der Hauptbetreuungsschwerpunkte je steirischer Versorgungsregion. Alkohol ist der vorrangige Hauptbetreuungsschwerpunkt in den Versorgungsregionen. Nur in Graz ist der Anteil der wegen Alkohol betreuten etwas geringer und liegt gleich auf mit der Opioid-Agonisten-Therapie. Die Opioid-Agonisten-Therapie (OAT) kommt im regionalen Vergleich am häufigsten in der Versorgungsregion Graz vor.
Abb. 914: Verteilung der Hauptbetreuungsschwerpunkte in ambulanten Suchthilfeeinrichtungen (direkt Betroffene und Angehörige).
Nach steirischen Versorgungsregionen fürSteiermark gesamt, 2023
Grundgesamtheit: gesamt = 5.792
Einrichtungsklientendaten aus dem Fördercontrolling Sucht; Berechnung und Darstellung: EPIG GmbH
Veröffentlicht am 20.11.2025, Download von https://gesundheitsbericht-steiermark.at/
Die Opioid-Agonisten-Therapie (OAT) ist eine sehr wirksame Dauertherapie einer chronischen Suchterkrankung mit Opioidbeteiligung. In der Steiermark wird ein ineinandergreifendes Dreistufenmodell der OAT umgesetzt. Die Therapie kann im niedergelassenen Bereich wohnortnah durchgeführt werden.
Um diese Versorgung mit der Opioid-Agonisten-Therapie flächendeckend sicherstellen zu können, ist es wichtig, dass die OAT in niedergelassenen Ordinationen und Primärversorgungseinheiten angeboten wird.
Im Zeitverlauf ändert sich die Zahl der Hauptbetreuungsschwerpunkte, bezogen auf die steirische Bevölkerung, nicht wesentlich.
Abb. 935: Verteilung der Hauptbetreuungsschwerpunkte in ambulanten Suchthilfeeinrichtungen (direkt Betroffene und Angehörige) im Zeitverlauf.
Für Steiermark gesamt für die Jahre 2020 bis 2023
Daten normiert je 10.000 EW
Grundgesamtheit: 2023 gesamt = 5.792
Einrichtungsklientendaten aus dem Fördercontrolling Sucht; Berechnung und Darstellung: EPIG GmbH
Veröffentlicht am 20.11.2025, Download von https://gesundheitsbericht-steiermark.at/
Stationäre Versorgung
Stationäre Aufenthalte aufgrund einer suchtspezifischen Hauptdiagnose erfolgen in einer Vielzahl an Einrichtungen, verteilt über ganz Österreich. Einige dieser Einrichtungen sind auf die Behandlung von Suchtkrankheiten spezialisiert (z.B. Anton-Proksch-Institut in Wien, Sonderkrankenanstalt De La Tour in Kärnten, Walkabout Therapiestation für Drogenkranke in der Steiermark).
Eine Auswertung der Krankenhaus-Entlassungsstatistik zeigt, dass über 90 % der Krankenhausaufenthalte von Steirer*innen mit einer suchtspezifischen Diagnose (3.460 Fälle gesamt) im Jahr 2023 in stationären Einrichtungen innerhalb der Steiermark erfolgten. Der größte Teil der stationären Versorgung erfolgt im LKH Graz II (62 % der Fälle), wo am Standort Süd das Zentrum für Suchtmedizin eingerichtet ist. Weiters scheinen in der Statistik auf: das LKH Universitätsklinikum Graz (10 % der Fälle ), das LKH Hochsteiermark (6,4 % der Fälle), die Barmherzigen Brüder in Graz (1,8 % der Fälle) und das Krankenhaus der Elisabethinen in Graz (0,8 % der Fälle). In der Sonderkrankenanstalt De La Tour in Kärnten wurden 85 Steirer*innen (2,5 %) betreut, am Anton-Proksch-Institut in Wien 16 Steirer*innen (0,5 %) und in der Walkabout Therapiestation für Drogenkranke 15 Steirer*innen (0,4 %). Die restlichen rund 15 % der Krankenhausaufenthalte mit einer suchtspezifischen Diagnose verteilen sich auf eine Vielzahl an Einrichtungen innerhalb und außerhalb der Steiermark.
Langfristige stationäre Angebote in Verbindung mit therapeutischen Wohngemeinschaften oder mit arbeitsrehabilitativen Angeboten stehen in der Steiermark folgende Einrichtungen zur Verfügung: das Aloisianum, der Grüne Kreis in Johnsdorf sowie die Vereine ReethiRa und Ubuntu.
Suchtartspezifische Versorgungsangebote
Hier geht es zu suchtartspezifischen Versorgungsangeboten in der Steiermark:
Schadensminimierende Maßnahmen
Schadensminimierende Maßnahmen sollen Drogen konsumierende Personen dabei unterstützen, die Risiken des Konsums möglichst gering zu halten. Vorrangig geht es um Angebote für Personen mit injizierendem Konsum und um Konsument*innen von illegalisierten Substanzen. Risiken dieser Konsumform sind z.B. Infektionskrankheiten wie Hepatitis C, Hepatitis B oder HIV. Schadensminimierende Angebote sind im Kapitel Illegalisierte Substanzen detailliert beschrieben.
Eine schadensminimierende Maßnahme, deren Umsetzung für Österreich empfohlen wird, ist die Etablierung von Drogenkonsumräumen bzw. sogenannten Gesundheitsräumen für sichere und hygienische Konsummöglichkeiten außerhalb des eigenen Wohnraums. In Europa werden Drogenkonsumräume in mehreren Ländern angeboten. Als erster Umsetzungsschritt sollte für Österreich ein Konzept für die Einführung dieser Maßnahme entwickelt werden .
Integrierte Versorgung
In Zusammenhang mit einer Suchterkrankung stößt eine Reintegration z.B. in den Arbeitsprozess oder in eine gesicherte Wohnsituation oft auf finanzielle und rechtliche Hürden. Eine Finanzierung aus der Behindertenhilfe, z.B. für betreute Wohnangebote, kann bei vorrangig bestehender Suchterkrankung nicht gewährt werden .
Viele der in der Steiermark vorhandenen Angebote für Menschen mit psychiatrischen Erkrankungen werden aktuell über das Steiermärkische Behindertengesetz (StBHG) finanziert. Dem Personenkreis der „Suchtkranken“ bleiben diese Angebote verwehrt. Die Leistungs- und Entgeltverordnung (LEVO-StBHG 2015) definiert eine Suchterkrankung, wenn Abhängigkeit im Vordergrund steht, als Kontraindikation für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Behindertengesetz.
Wohnen
Das „Versorgungskonzept Sucht. Steiermark 2030“ empfiehlt, Möglichkeiten der Inanspruchnahme von vorhandenen Strukturen der Wohnversorgung durch suchtkranke Menschen auf Ebene von verbesserten und gemeinsam abgestimmten rechtlichen und finanziellen sowie strukturellen oder kooperativen Rahmenbedingungen zu schaffen .
Arbeiten
In der Steiermark gibt es niederschwellige arbeitsintegrative Angebote, wie z.B. erfa, heidenspass und offline. Im Jahr 2023 wurden vonseiten der Initiative „erfa“ 109 Klient*innen in der ambulanten Suchthilfe betreut und unterstützt. Bei „heidenspass“ waren es 210 Personen.
Auch in den österreichweiten Empfehlungen für die Verbesserung der Versorgungssituation von Menschen mit Suchterkrankungen, die von der Gesundheit Österreich GmbH in einer Delphi-Befragung erarbeitet wurden, wird auf die Wichtigkeit von tagesstrukturierenden und arbeitsintegrativen Angeboten als stabilisierende, rehabilitierende und reintegrative Maßnahmen für Menschen mit chronischen Suchterkrankungen eingegangen.
Selbsthilfe
Die Selbsthilfegruppen in der Steiermark agieren inhaltlich krankheits- und/oder themenspezifisch und verfolgen somit unterschiedliche Ziele und Aufgaben. 26 Selbsthilfegruppen mit suchtspezifischem Schwerpunkt beschäftigen sich mit dem Thema Alkohol, jeweils drei Gruppen gibt es zum Schwerpunkt Essstörungen und illegalisierte Substanzen, zwei zur Spielsucht und eine Gruppe zu Alkohol- und Medikamentenmissbrauch. Für Mediensucht bzw. suchthafte Internetnutzung gibt es eine Selbsthilfegruppe mit Sitz in Wien. Einen Überblick zu allen Selbsthilfegruppen in der Steiermark finden sie hier.
Das Versorgungskonzept Sucht 2030 für die Steiermark definiert wichtige Bereiche, die Schnittstellen für die Versorgung von Menschen mit Suchterkrankungen bilden. Im Zentrum des Angebots stehen demnach die ambulanten Einrichtungen sowie deren aufsuchendes und nachgehendes Angebot. Wichtige Schnittstellen gibt es zu den Bereichen
- ambulante sozialpsychiatrische und psychosoziale Angebote,
- integrierte Angebote für verschiedene Zielgruppen,
- schadensminimierende Angebote,
- Angebote der Opioid-Agonisten-Therapie,
- Angebote in Krisen,
- primärversorgende Angebote,
- akutstationäre Versorgung,
- stationäre Therapie- und Rehabilitationsangebote,
- Angebote im Bereich Arbeit und Beschäftigung,
- Justizanstalten als spezifisches Setting,
- Selbsthilfe bzw. Peer-Angebote.
Sucht in der medizinischen Regelversorgung
Ärzt*innen in der medizinischen Regelversorgung sind wichtige Ansprechpersonen für Patient*innen mit riskanten oder abhängigen Konsummustern oder Verhaltensweisen. Sie betreuen und unterstützen diese Patient*innen und können sie zielgerichtet an Suchthilfeeinrichtungen verweisen.
Insbesondere die Primärversorgung mit ihrem interdisziplinär angelegten Unterstützungs- und Behandlungssystem sowie Apotheker*innen können einen großen Beitrag zur zielgerichteten Versorgung von Betroffenen leisten. Aufgrund unspezifischer Symptome erweist sich das Erkennen und Ansprechen einer Suchtsymptomatik im Rahmen der Regelversorgung oft als schwierig. Es benötigt Sensibilität und Bewusstsein, um auf unspezifische Anzeichen aufmerksam zu werden und potenziell Betroffene entsprechend beraten zu können .
Der Konsum von Alkohol, Tabak und Nikotin wird z.B. bei Vorsorgeuntersuchungen thematisiert. Auch die Einnahme von Medikamenten oder Symptome von Essstörungen sind Beispiele für Thematiken, die im Rahmen von Kontakten in der Regelversorgung auffallen und frühzeitig angesprochen werden sollten. Nicht zuletzt die Opioid-Agonisten-Therapie (OAT) unterstreicht die hohe Relevanz der Regelversorgung, wenn es um das Erkennen, Behandeln und Betreuen von Patient*innen mit Suchterkrankungen geht.
Aktualisiert am 20.11.2025